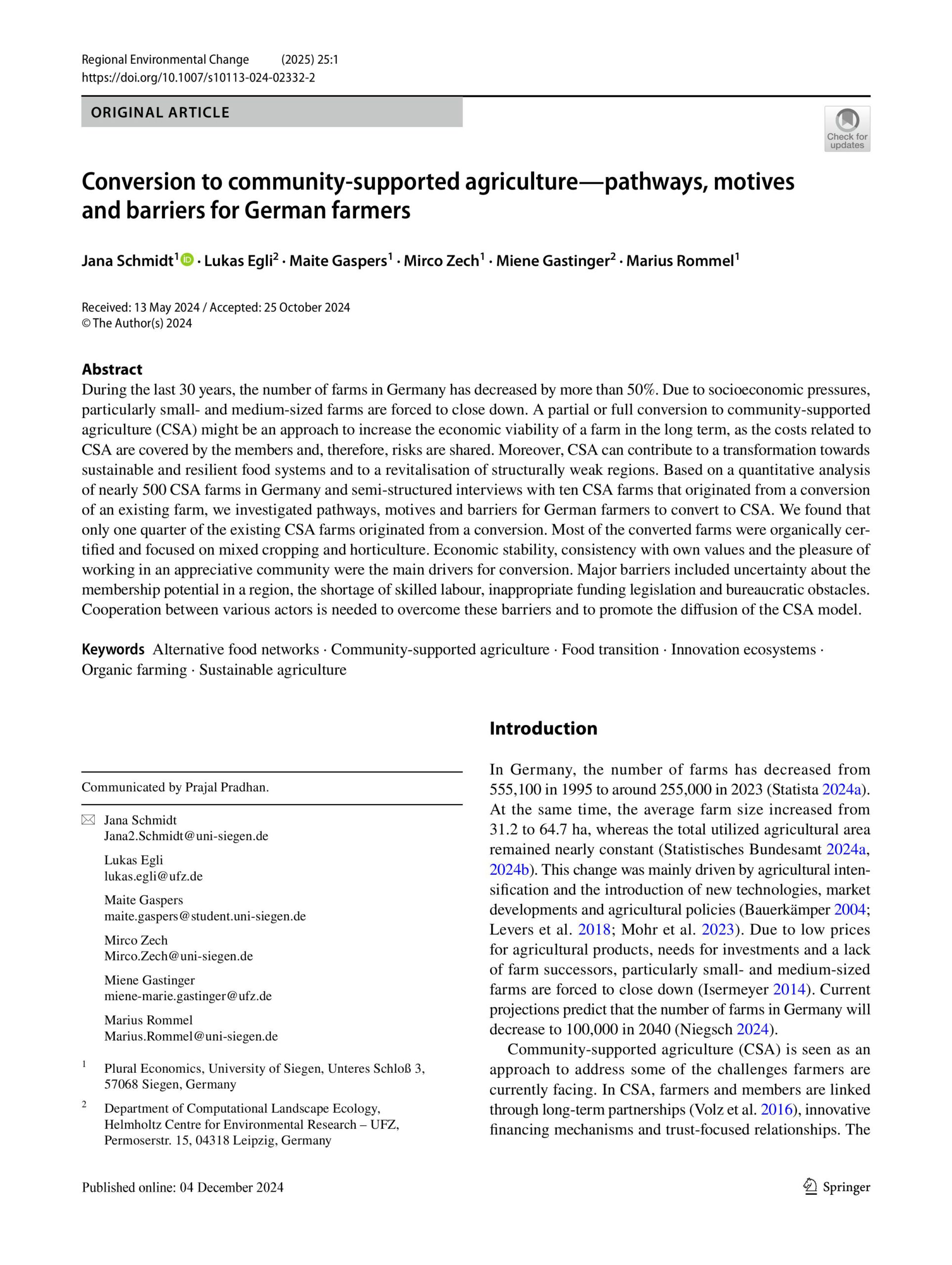Die Vielfalt der gemeinschaftsgetragenen Landwirtschaft
Unter dem Titel “Conversion to community-supported agriculture—pathways, motives and barriers for German farmers” veröffentlichen Jana Schmidt, Lukas Egli, Maite Gaspers, Mirco Zech, Miene Gastinger und Marius Rommel einen Artikel (peer reviewed) in dem Journal Regional Environmental Change.
Inhalt des Artikels: In den letzten 30 Jahren ist die Anzahl der landwirtschaftlichen Betriebe in Deutschland um mehr als 50% zurückgegangen. Aufgrund sozioökonomischer Zwänge sind insbesondere kleine und mittlere Betriebe vom Höfesterben betroffen. Eine Teil- oder Vollumstellung auf Solidarische Landwirtschaft könnte durch das Prinzip der Umlagefinanzierung ein Ansatz sein, die wirtschaftliche Stabilität insbesondere kleinbäuerlicher Betriebe zu erhöhen. Die Kosten des gesamten landwirtschaftlichen Betriebes – nicht das einzelne Lebensmittels – werden durch die Mitglieder unabhängig von der Ernte solidarisch getragen, was wiederum die Krisenresilienz erhöht. Darüber hinaus kann Solawi zu einer Transformation hin zu nachhaltigen, regionalen und resilienten Ernährungssystemen sowie zur Belebung strukturschwacher Regionen beitragen.
Auf Grundlage von qualitativen Interviews mit zehn Solawis – die aus einer Umstellung eines bestehenden landwirtschaftlichen Betriebes hervorgegangen sind – wurden Umstellungspfade, Auslöser, Motive und Hürden untersucht. Lediglich ein Viertel aller bestehenden Solawi-Betriebe in Deutschland sind aus einer Umstellung hervorgegangen, d.h. die meisten Solawis sind Neugründungen. Ein Großteil der Umstellungs-Betriebe waren Gartenbau- oder Mischkulturbetriebe und bereits vor der Umstellung biologisch zertifiziert. Der Wunsch nach wirtschaftlicher Stabilität und finanzieller Planungssicherheit, die Übereinstimmung mit den eigenen Werten und die Freude an der Arbeit in einer wertschätzenden Gemeinschaft waren die Haupttreiber für eine Umstellung auf Solawi. Zu den größten Hürden zählten Unsicherheiten über das Mitgliederpotenzial in der Region, der Fachkräftemangel insbesondere im Gemüseanbau sowie fehlende politische Unterstützung durch beispielsweise ungeeignete Fördergesetze und Subventionen sowie bürokratische Hürden.
Hier geht’s zum Download.